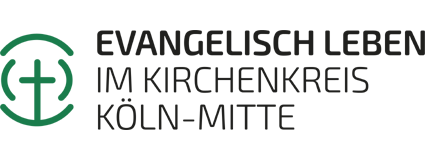Stiftungsforum zur ForuM-Studie: Folgen und Stand der Aufarbeitung
Brisante gesellschaftliche Themen anzupacken, sie mithilfe von Experten und Expertinnen zu diskutieren und in die Stadtgesellschaft zu tragen – das ist das Anliegen des mehrmals jährlich stattfindenden Stiftungsforums der Stiftung „Türen zum Nächsten“ der Evangelischen Kirchengemeinde Frechen. Diesmal war Stadtsuperintendent Bernhard Seiger zu Gast in der Evangelischen Kirche an der Hauptstraße, um über die ForuM-Studie, ihre Folgen und den Stand der Aufarbeitung zu informieren.
Pfarrerin Almuth Koch-Torjuul, Vorsitzende des Stiftungsrates, begrüßte die Gäste. Bernhard Seiger stellte zunächst fest, dass es sich um ein kompliziertes und vielschichtiges Thema handele. Es belaste die Betroffenen über Jahrzehnte und sei mit Scham behaftet. Auf Seiten der Kirche stünden die Begriffe „Schuld“, „Versagen“ und „Verbrechen“ im Raum.
Zeitenwende
Als die ForuM-Studie am 25. Januar 2024 veröffentlicht wurde, kam das einer „Zeitenwende“ in Hinblick auf das Selbstverständnis der evangelischen Kirche gleich. Die 870 Seiten umfassende unabhängige Untersuchung biete „schwere Kost“ und stelle vor die Herausforderung, „ein Gespür für dieses sensible Thema zu entwickeln“ und „sprachfähig“ zu werden. Um eventuellen Retraumatisierungen bei den Teilnehmenden vorzubeugen, wies Seiger auf die vorhandenen Vertrauenspersonen und Beratungsstellen hin.
Zunächst nahm er die Reaktionen auf die Studienergebnisse in den Blick, die „sehr unterschiedlich“ gewesen seien. Nach einem ersten großen Erschrecken hätten sich diese zwischen „Ich habe es geahnt!“, dem Wunsch nach Verdrängung sowie Empörung bis hin zu Austritten bewegt. Bei den Mitarbeitenden hätten die Erkenntnisse aus der ForuM-Studie zu Verunsicherung geführt. Seiger übte aber auch Medienkritik: Die Veröffentlichung der Studie sei „Aufmacher in allen Medien“ gewesen, aber „einen oder zwei Tage später war das Thema durch“. Dies sei zum einen der Ernüchterung geschuldet, zum anderen würden in der evangelischen Kirche jene „Gallionsfiguren“ fehlen, die im Falle der katholischen Kirche als medienwirksame Projektionsflächen dienten.
Externe Stellen beteiligen
Dann wandte Seiger sich den Schritten der Aufarbeitung zu und machte zunächst den Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit oder Qualität deutlich, dessen Lösung auch eine Frage der Glaubwürdigkeit sei. „Wir wollen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir würden nur oberflächlich aufarbeiten“, hielt er fest. Daher sei es besonders wichtig, externe Stellen an diesem Prozess maßgeblich zu beteiligen.
Bernhard Seiger bemängelte aber auch Fehler im Design der ForuM-Studie, die sich zu sehr an der katholischen Kirche orientiere. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen seien mit einer „disparaten Aktenlage“ konfrontiert gewesen, daher seien auch kaum Zentralakten eingesehen worden. Im Gegensatz zum katholischen Pendant seien auch andere Berufsgruppen (z.B. die Beschäftigten von Kinderheimen und KiTas) sowie Ehrenamtliche berücksichtigt worden, was die Vergleichbarkeit erschwere. Trotzdem handele es sich insgesamt um eine sehr gute Studie. Seiger hob die Bedeutung der Perspektive der Betroffenen (z.B. auf der Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Studie) hervor. „Diese Sichtweise hat ihr Recht“, betonte er. Jede Sichtweise, jede Erfahrung habe Dignität. Seiger machte deutlich, dass die persönliche Aufarbeitung des Geschehenen einen oft lebenslangen Prozess darstelle. „Wer betroffen ist, ist nicht einfach fertig“, sagte Seiger und zitierte eine Betroffene: „Ich war jahrzehntelang Opfer, dann war ich lange Betroffene, jetzt, wo wir miteinander sprechen, beginne ich langsam, die Kontrolle über mein Leben wiederzugewinnen.“
In einem dritten Schritt stellte der Stadtsuperintendent die Aufarbeitungskommission Rheinland-Westfalen-Lippe vor. Ein erstes Treffen Betroffener der Region fand im Juni dieses Jahres in Dortmund statt. Bei den etwa 60 Personen handele es sich um eine „disparate Gruppe“. Bei der Einrichtung der Aufarbeitungskommission, der die Kirchenkreise berichtspflichtig sind, habe man unter anderem vor der Frage gestanden: „Wie findet man eine legitimierte Interessenvertretung?“
Verschiedene Arten der Aufarbeitung
Den vierten Teil seines Vortrags widmete Bernhard Seiger den verschiedenen Arten der Aufarbeitung (individuelle, institutionelle und wissenschaftliche Aufarbeitung). Hier seien die Kirchenkreise gefragt. Es seien bereits differenzierte Fragebögen entwickelt worden, um zu klären, wo sich welche Akten befinden. Viele Vorfälle seien allerdings nicht dokumentiert. Momentan seien 23 Staatsanwält*innen zur Aufarbeitung der Fälle beauftragt. Dies trage mit dazu bei, die evangelische Kirche vom Vorwurf der Vertuschung zu entlasten. Auch das gemeindeinterne Gespräch sei wichtig. Um den richtigen Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt zu etablieren, seien verpflichtende Schulungen eingeführt worden, die auch in regelmäßigen Abständen (beispielsweise alle fünf Jahre) wiederholt werden müssten.
Dann warf Seiger einen kritischen Blick auf „unser Kirchenbild“. „Wir haben uns für die liberalere und lockerere Kirche gehalten“, stellte er fest. Oft seien es gerade charismatische Persönlichkeiten, die ihren Einfluss auf Jugendliche oder junge Erwachsene ausnutzten. Es habe bisweilen keine Kontrolle gegeben und zu wenig Transparenz. Seiger zitierte die Studie, die in diesem Zusammenhang recht schonungslos von „organisierter Verantwortungslosigkeit“ spricht. Die Bereiche Pfarrhaus und Freizeiten seien besonders ins Blickfeld geraten. Allerdings fehle in der ForuM-Studie ein (geplantes) Kapitel über die Täter, da schlicht niemand sich bereit erklärt habe zu sprechen.
Theologische Perspektiven
Abschließend wandte sich Seiger den theologischen Perspektiven zu. Zum einen gehe es, auch in der evangelischen Kirche, um Machtstrukturen, aber ab den 80er Jahren spiele auch der spirituelle Faktor bei der Entstehung von Abhängigkeitsverhältnissen eine Rolle. Das Spirituelle sei „Faszinosum und Tremendum“ und durch die große Nähe von Sexualität und Spiritualität könne Letztere als Einfallstor dienen. Theologische Fragen wirft auch das Thema der Schuld auf. Sie sei immer individuell und müsse konkret benannt werden, auch Nichthandeln und Wegsehen.
Während der anschließenden Diskussion kamen viele persönliche Erfahrungen, vor allem mit den bereits stattgefundenen Schulungen zur Sprache. Bernhard Seiger gab Auskunft über die konkreten Abläufe in Verdachtsfällen und seine Rolle als Stadtsuperintendent. Es ging aber auch um die Frage der Balance zwischen Vertrauen und notwendiger Prävention. Pfarrerin Almuth Koch-Torjuul zog interessante Parallelen zum kritischen Umgang mit dem Schuldbegriff in der feministischen Theologie und Bernhard Seiger forderte: „Wir müssen die Kreuztheologie neu denken!“ Nicht mehr (allein) der Sünder dürfe Trost und Vergebung unter dem Kreuz finden, sondern dort solle vor allem Platz für das Leid der Opfer bzw. Betroffenen sein. Auch die traditionellen Schuldbekenntnisse müssten angesichts der Studienergebnisse überdacht und ggf. neu formuliert werden.
„Wir dürfen nicht zu schnell mit Versöhnung kommen“, forderte Seiger. „Es ist nicht die Aufgabe der Betroffenen zu vergeben.“ Er blickte auch in die Zukunft: „Wir machen Fortschritte. Wir sehen hin und werden sprachfähiger.“
Text: Priska Mielke
Foto(s): Priska Mielke
Der Beitrag Stiftungsforum zur ForuM-Studie: Folgen und Stand der Aufarbeitung erschien zuerst auf Evangelischer Kirchenverband Köln und Region.