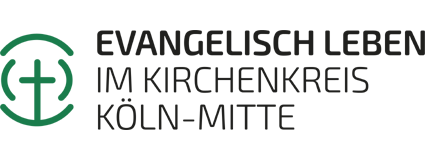Podiumsgespräch in Köln: Experten debattieren über Bonhoeffer-Film
Wenn ein Film, der die Vita eines deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts zum Gegenstand hat, bereits vor seiner Deutschlandpremiere für Schlagzeilen sorgt, dann haben die Macher eines schon erreicht: die nötige Aufmerksamkeit. Das 132-minütige Biopic „Bonhoeffer“ sorgte hierzulande nicht nur durch das aggressive und auf eine evangelikale Zielgruppe zugeschnittene Marketing des amerikanischen Filmvertriebs „Angel Studios“ für Aufregung, sondern auch durch den äußerst „kreativen“ Umgang mit historischen Fakten.
Im Kölner CINEDOM konnten sich Neugierige bereits vor dem eigentlichen Kinostart ihr eigenes Bild machen. Die Preview wurde begleitet von einem Podiumsgespräch mit dem Regisseur Todd Komarnicki, dem Schauspieler Patrick Mölleken, der im Film Dietrich Bonhoeffers Bruder Walter verkörpert, sowie dem Journalisten und Bonhoeffer-Experten Arnd Henze.
Stimmig gezeichnete Milieu-Skizze
Komarnicki beginnt seine nicht durchgehend chronologisch, sondern in Rückblenden erzählte filmische Biografie durchaus vielversprechend: Die Kinobesuchenden werden entführt in eine stimmig gezeichnete Milieu-Skizze einer gutbürgerlichen Familie des Jahres 1913 und begegnen dem siebenjährigen Dietrich als aufgewecktem, musikalischem und fantasiebegabten Knaben, dessen Kindheit geprägt ist von elterlicher Liebe und der engen Beziehung zu seinem großen Bruder Walter.
Kinobesuch wird zur Fehlersuche

Dass es sich nicht um eine Dokumentation handelt, dürfte allen Preview-Besuchenden im Vorhinein klar gewesen sein. Welche Freiheiten sich der Regisseur und Drehbuchautor in Personalunion dann allerdings herausnimmt, kommt einer Missachtung der Intelligenz des Publikums gleich. Da gehen Ungenauigkeiten wie die „Vorverlegung“ des Amtsantritts von Reichsbischof Müller noch als Petitesse durch. Die Figur Martin Niemöllers, den Komarnicki kurzerhand zum Bischof befördert, ist derart verzerrt gezeichnet, dass man vermuten könnte, dass hier aus dramaturgischen Gründen mehrere historische Persönlichkeiten zu einer „verschmolzen“ werden. Anstatt sich auf die gar nicht mehr nur hypothetischen Fragen einlassen zu können, die Dietrich Bonhoeffers Biografie an jede(n) Einzelne(n) stellt, wurde der Kinobesuch so zur Fehlersuche. Am ärgerlichsten ist allerdings die Schlussszene: Bonhoeffers Hinrichtung, die in Wirklichkeit eine wenig fotogene, nämlich auf größtmögliche Demütigung des Gefangenen angelegte Prozedur war, wird bei Komarnicki zu einem kitschig-verklärten Himmelfahrtsverschnitt, Rezitation der Bergpredigt inklusive.
Wie weit darf künstlerische Freiheit gehen?
Bei der anschließenden Diskussion ging es dann auch um die sehr grundlegende Frage, wie weit künstlerische Freiheit gehen darf und wann ein ausgedehnter kreativer Freiraum zum Einfallstor für die Vereinnahmung durch Populisten, rechte Ideologen und andere Liebhaber „alternativer Fakten“ werden kann.
„Wer war Bonhoeffer für Sie?“
Moderatorin Sarika Feriduni wollte von den Podiumsteilnehmenden zunächst wissen: „Wer war Bonhoeffer für Sie?“ Regisseur Todd Komarnicki gab zu, dass sein Zugang zu Dietrich Bonhoeffer ein sehr persönlicher sei. Besonders dessen 1944 entstandenes (auch im Film erwähntes) Gedicht „Wer bin ich?“ zeige Bonhoeffers „Ringkampf mit der eigenen Seele“. Er habe die Bücher des deutschen Theologen gelesen. „Der Mann, den ich darin fand, ist in diesem Film!“, erklärte Komarnicki. Bonhoeffer sei „kein Mann für alle Zeiten, aber ein Mann für unsere Zeit“.
Deutlich zurückhaltender äußerte sich der Journalist und Bonhoeffer-Kenner Arnd Henze. Zunächst einmal sei Bonhoeffer „ein Mensch, der tatsächlich gelebt hat.“ Er sei sehr jung gewesen, als er vor existenzielle Entscheidungen gestellt wurde, habe die Realität richtig eingeschätzt. Auch verwies Henze darauf, dass der spätere Widerstandskämpfer einen Entwicklungsprozess durchgemacht habe.
„Ein Mann des Glaubens“
Schauspieler Patrick Mölleken, der in der Diskussion insgesamt zu wenig zu Wort kam, erklärte, Bonhoeffer sei für ihn „ein Mann des Glaubens, der den Mut hatte, das zu tun, wovon er überzeugt war“ und betonte dessen „Tagesaktualität“.
Arnd Henze, der von Anfang an zu den scharfen Kritikern des Films gehört hatte, sagte, er sei vor allem von der Werbung alarmiert gewesen. „Bonhoeffer wird in den USA schon lange vereinnahmt“, stellte er fest. Der auch im Film fallende Satz: „We are invaded from within!“, erinnere an Verschwörungserzählungen von einem „Deep state“. Das (für den deutschen Markt „entschärfte“) Poster, das „Bonhoeffer mit einer Knarre in der Hand“ zeige, sowie der Slogan „The true untold story“ würden ebenfalls in diese Richtung deuten.
Komarnicki erwiderte, er sei dankbar, darüber sprechen zu können. Die Kontroverse um den Film sei in England und den USA kaum zu spüren gewesen. An Arnd Henze gewandt, erklärte er: „Ich bin auf Ihrer Seite!“ Sein Film sei lediglich „eine weitere Stimme im Chor“. Komarnicki empfahl dem Publikum die Lektüre von Bonhoeffers „Briefen aus dem Gefängnis“ und betonte seine Bereitschaft „in den Dialog zu treten“.
Arnd Henze definierte Streiten als „eine Form der Wertschätzung“. Der Film habe sich anfällig gemacht, weil er grob fahrlässig mit den historischen Fakten umgeht. Als Beispiel nannte er die bereits erwähnte Schlussszene.
„Es gibt nicht viele Filme, in denen der Held am Schluss stirbt“
Komarnicki rechtfertigte diese jedoch mit den Worten: „Es gibt nicht viele Filme, in denen der Held am Schluss stirbt.“ Das akkurat darzustellen, hätte die Hoffnung nicht „rübergebracht“.

Arnd Henze gab zu bedenken: „Wir haben seit 20 Jahren keinen Bonhoeffer-Film mehr gehabt“ und ließ damit durchblicken, dass er Komarnickis Versuch einer sehr persönlichen filmischen Annäherung als eine vertane Chance betrachtet, die Aktualität des widerständigen Theologen einem größeren Kinopublikum mit der gebotenen Tiefe, Komplexitätstoleranz und Faktentreue zu vermitteln. Bonhoeffer habe nicht nur die Bibel gelesen, sondern auch die Zeitung, meinte Henze und ergänzte: „Aus diesem Film kann man über Geschichte leider wenig lernen.“
Der Regisseur und Drehbuchautor entgegnete, er habe das Drehbuch bereits 2019 geschrieben, da sei die politische Entwicklung noch gar nicht absehbar gewesen. Kunst sei immer offen für Vereinnahmung. Um das zu illustrieren, führte Komarnicki Picassos Gemälde „Guernica“ als Beispiel an. Er teile Henzes Sorge und habe Respekt für dessen intensive Beschäftigung mit Dietrich Bonhoeffer. Letztlich sei die Lektüre seiner Schriften der Weg zu Bonhoeffer, denn niemand könne Bonhoeffer besser erklären als er selbst.
Arnd Henze erinnerte an den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Damals seien Attentäter als Widerstandskämpfer gefeiert worden.
„Wir können Populismus nicht verhindern“
Komarnicki wandte ein, bei der Premiere hätten alle gesagt, dass Bonhoeffer ihre Sichtweise vertrete. „Wir können Populismus nicht verhindern“, meinte er und sprach sich vehement für „Redefreiheit“ aus. Komarnicki mutmaßte: „Wenn Bonhoeffer noch leben würde, hätte er auch mit der extremen Rechten geredet.“

Ein Herr aus dem Publikum erinnerte daran, dass Bonhoeffer bereits am 1. Februar 1933 eine Radioansprache („Wandel des Führerbegriffs“) gehalten habe, die er jedoch wegen angeblicher technischer Probleme nicht zu Ende bringen konnte. „Das Annehmen der Kritik“, vermutete der Zuschauer, „hätte den Film vor Vereinnahmung geschützt.“ Komarnicki erwiderte, die Rede sei ursprünglich im Skript vorhanden gewesen, die Szene habe jedoch einem Faktencheck nicht standgehalten. Die Wortmeldung zeige, wie unmöglich diese Aufgabe sei. Niemand könne alles wissen.
Nun schaltete sich Patrick Mölleken ein. Der Film habe beide Lager zum Nachdenken angeregt und könne vor allem jungen Menschen als Inspiration dienen.
„Die größte Gefahr ist die Auflösung faktenbasierter Gesprächsmöglichkeiten“
Arnd Henze postulierte: „Die größte Gefahr ist die Auflösung faktenbasierter Gesprächsmöglichkeiten.“ Dies sei eine „gemeinsame Aufgabe“.
Während der Regisseur sein Werk mit den Attributen „ein wichtiger Film über einen wichtigen Mann zur richtigen Zeit“ beschrieb, wollte Arnd Henze den Film gemeinsam mit seiner Rezeptionsgeschichte betrachtet wissen. Auf die Abschlussfrage der Moderatorin, was er aus der Debatte um seinen Film mitnehme, nannte Komarnicki die Verletzung durch den Offenen Brief der Familie Bonhoeffer. Diese hatte sich deutlich von dem Film und dessen Vermarktung distanziert.
Wer deren Perspektive „aus erster Hand“ kennenlernen möchte, hat dazu am 9. April, dem 80. Jahrestag der Ermordung Dietrich Bonhoeffers, um 19 Uhr die Gelegenheit. Dann diskutieren in der Kartäuserkirche Arnd Henze, Pfarrer Mathias Bonhoeffer (Großneffe Dietrich Bonhoeffers) und die Theologin Philine Lewek.
Text: Priska Mielke
Foto(s): Priska Mielke/ Pressebilder www.kinostar.com/filmverleih/bonhoeffer
Der Beitrag Podiumsgespräch in Köln: Experten debattieren über Bonhoeffer-Film erschien zuerst auf Evangelischer Kirchenverband Köln und Region.