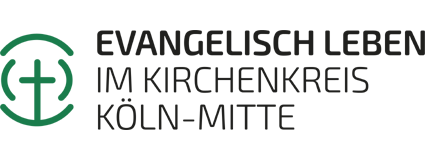Von Porz nach Tel Aviv: Orna Porat – Schauspielerin, Kulturikone, Ehrenbürgerin – dreifaches posthumes Comeback nach Köln
In Israel ist Orna Porat eine Legende. In Köln erinnern sich nur wenige an Irene Klein, die 1924 als Tochter eines katholischen Vaters und einer evangelischen Mutter in Porz zur Welt kam, später in der dortigen Lukaskirche konfirmiert und noch später in Israel eine gefeierte Schauspielerin wurde. Die Lebensgeschichte einer faszinierenden Frau stand im Mittelpunkt eines Abends der Melanchthon-Akademie mit der Überschrift „Orna Porat: Berühmt in Israel! – Vergessen in Köln?“ Arnd Henze hatte die Moderation übernommen und begrüßte Lital Porat, Tochter von Orna Porat, Dr. Rolf Theobold, Pfarrer an der Lukaskirche, Angelika Golub, die die Anmerkungen von Lital Porat übersetzte, und Monika Möller, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Köln-Tel Aviv.
Von der NS-Jugendbewegung zur Bühne: Irene Kleins frühe Jahre
Dass Orna Porat einmal den Israel-Preis, die höchste Auszeichnung des Landes für Leistungen in Wissenschaft und Kultur, bekommen würde, wurde ihr nicht an der Wiege gesungen. In ihrer Jugend war sie sogar von der nationalsozialistischen Jugendorganisation „Bund Deutscher Mädel“ (BDM) derart fasziniert, dass sie dieser gegen den Willen ihrer Eltern beitrat. Aber schnell wurde klar, dass ihre eigentliche Leidenschaft dem Theater galt, erzählte ihre Tochter im Haus der Evangelischen Kirche. Zunächst stimmte ihr Vater zu, dass sie das Gymnasium besuchen konnte. 1941 wurde Orna Porat, damals noch Irene Klein, als Kindermädchen zu einem hohen NS-Offizier nach Schleswig beordert. Am dortigen Theater erhielt sie ein erstes Engagement, nachdem sie ein Jahr lang Schauspielunterricht genommen hatte. Einer der Schauspielschüler sei vorher Wächter im KZ Treblinka gewesen und hätte ihr von den Greueltaten erzählt, berichtete Lital Porat. 1943 sei das Theater in Schleswig geschlossen worden und alle Mitarbeitenden in Straflager geschickt worden, um kriegswichtige Güter zu produzieren. Bei der Auflösung des Lagers nach Kriegsende lernte Orna ihren späteren Mann kennen. Josef Proter stammte ebenfalls aus Köln, war Jude und vor den Nazis nach Palästina geflüchtet. Seine Mutter war in Auschwitz umgebracht worden. Proter arbeitete für den englischen Geheimdienst in Deutschland. Ihm fiel eine Liste in die Hände mit polnischen und russischen Namen derer, die in ihre Heimatländer zurückkehren wollten. Ein deutscher Name stach heraus: Irene Klein. Die war mittlerweile Sozialistin und wollte eigentlich nach Russland auswandern. „Bei dem Verhör hat sich meine Mutter sofort in meinen Vater verliebt. Bei ihm hat es drei Wochen gedauert. Sie hat ihm nie verziehen, dass es bei ihm so lange gedauert hat“, erzählte Lital Porat mit einem Lächeln. Orna und Josef heirateten und zogen nach Palästina.
Theater, Sprache, Kinder: Ein Leben für die Kultur Israels
Während Josef Hebräisch sprach, lernte Orna die Sprache abends nach Feierabend. Das Ehepaar schlug sich zunächst mit Gelegenheitsjobs durch. „Meine Mutter hatte keine Angst, sich in einem neuen Land zurechtzufinden“, sagte Lital Porat. Nach Absagen wurde sie schließlich doch beim Cameri-Theater angenommen und spielte schon bald große Rollen in Stücken von Bertolt Brecht und Arthur Miller – natürlich auf Hebräisch. Und da schon als Orna Porat. Jüdin wurde sie erst später. Zahlreiche Preise nahm sie während ihrer Karriere entgegen. Unter anderem wurde sie Ehrenbürgerin von Tel Aviv. Besonders am Herzen lag Orna Porat das Theater für Kinder und Jugendliche. 1970 gründete sie das Orna-Porat-Kinder-und-Jugendtheater, das bis heute fortbesteht. 2015 starb Orna Porat im Alter von 91 Jahren. „Sie war ein kultureller Gigant und diejenige, die das Theater in Israel gesellschaftsfähig gemacht hat“, hat Shimon Peres, ehemaliger Staatspräsident Israels, über sie gesagt. „Meine Mutter hat sich selbst nicht so ernst genommen. Ernst genommen hat sie das, was sie tat“, erinnerte sich ihre Tochter. „Ich bin vier Tage nach Ornas Tod an die Lukaskirche gekommen“, erzählte Pfarrer Theobold. Er hat sich intensiv mit ihr beschäftigt und eine besondere Beziehung aufgebaut: „Irgendwie hat sie mich adoptiert.“ Monika Möller vom Partnerschaftsverein hat Orna kennengelernt. 1998 war Möller zu Besuch in Tel Aviv und erfuhr von einer gebürtigen Kölnerin, die dort zu Ruhm und Ehren gekommen war. „Da bin ich sofort hellhörig geworden. Von Orna Porat hatte ich nie gehört. Ich habe sie besucht. Sie war mir auf Anhieb sympathisch. Eine faszinierende und bodenständige Frau, die mir sofort einen Zitronenlikör anbot.“ 2005, 40 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, war Orna Porat eine Woche in Köln. „Wir sind am Porzer Rheinufer spazieren gegangen, waren auf dem jüdischen Friedhof in Porz und haben auch die Lukaskirche besucht“, erinnerte sich Monika Möller. „Eine sehr schöne Woche.“
Text: Stefan Rahmann
Foto(s): Stefan Rahmann
Der Beitrag Von Porz nach Tel Aviv: Orna Porat – Schauspielerin, Kulturikone, Ehrenbürgerin – dreifaches posthumes Comeback nach Köln erschien zuerst auf Evangelischer Kirchenverband Köln und Region.